Seine Vergangenheit war jüdisch, aber heute sieht er Israel als eine der rassistischsten Gesellschaften in der westlichen Welt. Der Historiker Shlomo Sand erklärt, warum er nicht mehr Jude sein will.
von Shlomo Sand
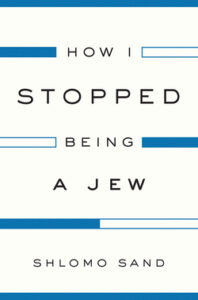 „Wenn ich weit weg von Israel bin, sehe ich meine Straßenecke in Tel Aviv und freue mich auf den Moment, in dem ich zu ihr zurückkehren kann“ … Shlomo Sand.
„Wenn ich weit weg von Israel bin, sehe ich meine Straßenecke in Tel Aviv und freue mich auf den Moment, in dem ich zu ihr zurückkehren kann“ … Shlomo Sand.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verließ mein Vater die talmudische Schule, hörte dauerhaft auf, in die Synagoge zu gehen, und drückte regelmäßig seine Abneigung gegen Rabbiner aus. An diesem Punkt in meinem eigenen Leben, im frühen 21. Jahrhundert, fühle ich mich wiederum moralisch verpflichtet, endgültig mit dem Stammesjudäozentrismus zu brechen. Ich bin mir heute völlig bewusst, nie ein wirklich säkularer Jude gewesen zu sein, und verstehe, dass ein solches imaginäres Merkmal keine spezifische Grundlage oder kulturelle Perspektive hat und dass seine Existenz auf einer hohlen und ethnozentrischen Sicht der Welt basiert. Früher glaubte ich fälschlicherweise, dass die jiddische Kultur der Familie, in der ich aufgewachsen bin, die Verkörperung der jüdischen Kultur sei. Wenig später, inspiriert von Bernard Lazare, Mordechai Anielewicz, Marcel Rayman und Marek Edelman – die alle Antisemitismus, Nazismus und Stalinismus bekämpften, ohne eine ethnozentrische Sichtweise einzunehmen – identifizierte ich mich als Teil einer unterdrückten und abgelehnten Minderheit. In der Gesellschaft sozusagen des sozialistischen Führers Léon Blum, des Dichters Julian Tuwim und vieler anderer blieb ich hartnäckig ein Jude, der diese Identität aufgrund von Verfolgungen und Mördern, Verbrechen und deren Opfern akzeptiert hatte.
Jetzt, da ich mir schmerzlich bewusst geworden bin, dass ich mich israelisch anhafte, per Gesetz in eine fiktive Ethnos von Verfolgern und ihren Unterstützern assimiliert wurde und in der Welt als einer der exklusiven Clubs der Auserwählten und ihrer Geiger erschienen bin, möchte ich zurücktreten und aufhören, mich als Jude zu betrachten.
Obwohl der Staat Israel nicht bereit ist, meine offizielle Nationalität von „Jude“ in „Israeli“ umzuwandeln, wage ich zu hoffen, dass freundliche Philosemiten, engagierte Zionisten und erhabene Antizionisten, die alle so oft von essenzialistischen Vorstellungen genährt werden, meinen Wunsch respektieren und aufhören werden, mich als Juden zu katalogisieren. Tatsächlich ist mir das, was sie denken, wenig wichtig und noch weniger, was die verbleibenden antisemitischen Idioten denken. Angesichts der historischen Tragödien des 20. Jahrhunderts bin ich entschlossen, keine kleine Minderheit mehr in einem exklusiven Club zu sein, dem andere weder die Möglichkeit noch die Qualifikation haben, sich anzuschließen.
Durch meine Weigerung, Jude zu sein, vertrete ich eine Spezies im Zuge des Verschwindens. Ich weiß, dass ich, indem ich darauf bestehe, dass nur meine historische Vergangenheit jüdisch war, während meine alltägliche Gegenwart (im Guten wie im Schlechten) israelisch ist, und schließlich, dass meine Zukunft und die meiner Kinder (zumindest die Zukunft, die ich mir wünsche) von universellen, offenen und großzügigen Prinzipien geleitet werden muss, der vorherrschenden Mode zuwiderläuft, die sich am Ethnozentrismus orientiert.
Als Historiker der Moderne stelle ich die Hypothese auf, dass die kulturelle Distanz zwischen meinem Urenkel und mir genauso groß oder größer sein wird als die, die mich von meinem eigenen Urgroßvater trennt. Umso besser! Ich habe das Pech, jetzt unter zu vielen Menschen zu leben, die glauben, dass ihre Nachkommen ihnen in jeder Hinsicht ähneln werden, denn für sie sind Völker ewig – erst recht ein Rassenmensch wie die Juden.
Ich bin mir bewusst, dass ich in einer der rassistischsten Gesellschaften der westlichen Welt lebe. Rassismus ist bis zu einem gewissen Grad überall präsent, aber in Israel existiert er tief im Geist der Gesetze. Es wird in Schulen und Hochschulen gelehrt, in den Medien verbreitet, und vor allem und am schrecklichsten, in Israel wissen die Rassisten nicht, was sie tun und fühlen sich deshalb in keiner Weise verpflichtet, sich zu entschuldigen. Dieses Fehlen eines Bedürfnisses nach Selbstrechtfertigung hat Israel zu einem besonders geschätzten Bezugspunkt für viele Bewegungen der extremen Rechten auf der ganzen Welt gemacht, Bewegungen, deren Vergangenheit des Antisemitismus nur zu gut bekannt ist.
In einer solchen Gesellschaft zu leben, ist für mich immer unerträglicher geworden, aber ich muss auch zugeben, dass es nicht weniger schwierig ist, mich woanders zu Hause zu fühlen. Ich bin selbst ein Teil der kulturellen, sprachlichen und sogar konzeptionellen Produktion des zionistischen Unternehmens, und ich kann das nicht rückgängig machen. Durch meinen Alltag und meine Grundkultur bin ich Israeli. Ich bin nicht besonders stolz darauf, genauso wie ich keinen Grund habe, stolz darauf zu sein, ein Mann mit braunen Augen und durchschnittlicher Größe zu sein. Ich schäme mich oft sogar für Israel, besonders wenn ich Beweise für seine grausame militärische Kolonisierung mit seinen schwachen und wehrlosen Opfern erlebe, die nicht Teil des „auserwählten Volkes“ sind.
Früher in meinem Leben hatte ich einen flüchtigen utopischen Traum, dass sich ein palästinensischer Israeli in Tel Aviv genauso zu Hause fühlen sollte wie ein jüdischer Amerikaner in New York. Ich kämpfte und suchte danach, dass das zivile Leben eines muslimischen Israelis in Jerusalem dem des jüdischen Franzosen ähnelt, dessen Haus in Paris ist. Ich wollte, dass israelische Kinder christlicher afrikanischer Einwanderer so behandelt werden, wie die britischen Kinder von Einwanderern vom indischen Subkontinent in London sind. Ich hoffte von ganzem Herzen, dass alle israelischen Kinder gemeinsam in denselben Schulen unterrichtet würden. Heute weiß ich, dass mein Traum unverschämt anspruchsvoll ist, dass meine Forderungen übertrieben und unverschämt sind, dass die bloße Tatsache, sie zu formulieren, von Zionisten und ihren Unterstützern als Angriff auf den jüdischen Charakter des Staates Israel und damit als Antisemitismus angesehen wird.
„Ich schäme mich oft für Israel, besonders wenn ich Beweise für seine grausame militärische Kolonisierung mit seinen schwachen und wehrlosen Opfern sehe, die nicht Teil des „auserwählten Volkes“ sind“, schreibt Shlomo Sand.
So seltsam es auch erscheinen mag, und im Gegensatz zum eingesperrten Charakter der säkularen jüdischen Identität scheint die Behandlung der israelischen Identität als politisch-kulturell und nicht als „ethnisch“ das Potenzial zu bieten, eine offene und integrative Identität zu erreichen. Nach dem Gesetz ist es in der Tat möglich, ein israelischer Staatsbürger zu sein, ohne ein säkularer „ethnischer“ Jude zu sein, an seiner „Suprakultur“ teilzunehmen und gleichzeitig die eigene „Infrakultur“ zu bewahren, die hegemoniale Sprache zu sprechen und parallel eine andere Sprache zu kultivieren, verschiedene Lebensweisen aufrechtzuerhalten und verschiedene miteinander zu verschmelzen. Um dieses republikanische politische Potenzial zu festigen, wäre es natürlich notwendig, die Stammeshermetik längst aufgegeben zu haben, zu lernen, den Anderen zu respektieren und ihn oder sie als gleichwertig willkommen zu heißen, und die Verfassungsgesetze Israels zu ändern, um sie mit demokratischen Prinzipien vereinbar zu machen.
Am wichtigsten, wenn es kurzzeitig vergessen wurde: Bevor wir Ideen zur Änderung der israelischen Identitätspolitik einbringen, müssen wir uns zuerst von der verfluchten und endlosen Besatzung befreien, die uns auf den Weg in die Hölle führt. Tatsächlich ist unsere Beziehung zu denen, die Bürger zweiter Klasse Israels sind, untrennbar mit unserer Beziehung zu denen verbunden, die in immenser Not am Ende der Kette der zionistischen Rettungsaktion leben. Diese unterdrückte Bevölkerung, die seit fast 50 Jahren unter der Besatzung lebt, ohne politische und bürgerliche Rechte, auf Land, das der „Staat der Juden“ als sein eigenes betrachtet, bleibt von der internationalen Politik verlassen und ignoriert. Ich erkenne heute an, dass mein Traum von einem Ende der Besatzung und der Schaffung einer Konföderation zwischen zwei Republiken, israelischen und palästinensischen, eine Chimäre war, die das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Parteien unterschätzte.
Zunehmend scheint es bereits zu spät zu sein; alles scheint bereits verloren zu sein, und jede ernsthafte Annäherung an eine politische Lösung ist festgefahren. Israel hat sich daran gewöhnt und ist nicht in der Lage, sich von seiner kolonialen Herrschaft über ein anderes Volk zu befreien. Die Welt draußen tut leider auch nicht das, was nötig ist. Seine Reue und sein schlechtes Gewissen hindern es daran, Israel davon zu überzeugen, sich an die Grenzen von 1948 zurückzuziehen. Israel ist auch nicht bereit, die besetzten Gebiete offiziell zu annektieren, da es dann der besetzten Bevölkerung die gleiche Staatsbürgerschaft gewähren und sich allein dadurch in einen binationalen Staat verwandeln müsste. Es ist eher wie die mythologische Schlange, die ein zu großes Opfer verschluckt hat, aber lieber erstickt, als es aufzugeben.
Bedeutet das, dass auch ich die Hoffnung aufgeben muss? Ich lebe in einem tiefen Widerspruch. Ich fühle mich wie ein Exil angesichts der wachsenden jüdischen Ethnisierung, die mich umgibt, während gleichzeitig die Sprache, in der ich spreche, schreibe und träume, überwiegend Hebräisch ist. Wenn ich mich im Ausland befinde, fühle ich Nostalgie für diese Sprache, das Vehikel meiner Emotionen und Gedanken. Wenn ich weit weg von Israel bin, sehe ich meine Straßenecke in Tel Aviv und freue mich auf den Moment, in dem ich zu ihr zurückkehren kann. Ich gehe nicht in Synagogen, um diese Nostalgie zu zerstreuen, weil sie dort in einer Sprache beten, die nicht meine ist, und die Menschen, die ich dort treffe, haben absolut kein Interesse daran zu verstehen, was es für mich bedeutet, Israeli zu sein.
In London sind es die Universitäten und ihre Studenten beiderlei Geschlechts, nicht die talmudischen Schulen (wo es keine Studentinnen gibt), die mich an den Campus erinnern, auf dem ich arbeite. In New York sind es die Cafés in Manhattan, nicht die Brooklyn-Enklaven, die mich einladen und anziehen, wie die von Tel Aviv. Und wenn ich die wimmelnden Pariser Buchhandlungen besuche, fällt mir die hebräische Buchwoche ein, die jedes Jahr in Israel organisiert wird, nicht die heilige Literatur meiner Vorfahren.
Meine tiefe Verbundenheit mit dem Ort dient nur dazu, den Pessimismus zu schüren, den ich ihm gegenüber empfinde. Und so tauche ich oft in Verzweiflung über die Gegenwart und Angst vor der Zukunft ein. Ich bin müde und spüre, dass die letzten Blätter der Vernunft von unserem Baum des politischen Handelns fallen und uns angesichts der Launen der schlafwandelnden Zauberer des Stammes unfruchtbar machen. Aber ich kann es mir nicht erlauben, völlig fatalistisch zu sein. Ich wage zu glauben, dass, wenn es der Menschheit gelingt, ohne Atomkrieg aus dem 20. Jahrhundert hervorzutreten, alles möglich ist, auch im Nahen Osten. Wir sollten uns an die Worte von Theodor Herzl erinnern, dem Träumer, der dafür verantwortlich ist, dass ich Israeli bin: „Wenn Sie so wollen, ist es keine Legende.“
Als Spross der Verfolgten, die aus der europäischen Hölle der 1940er Jahre hervorgingen, ohne die Hoffnung auf ein besseres Leben aufgegeben zu haben, erhielt ich vom verängstigten Erzengel der Geschichte nicht die Erlaubnis, abzudanken und zu verzweifeln. Deshalb werde ich, um ein anderes Morgen zu beschleunigen, und was auch immer meine Kritiker sagen, weiter schreiben.
Dies ist ein bearbeiteter Auszug aus How I Stopped Being a Jew von Shlomo Sand, veröffentlicht von Verso bei £ 9.99. Kaufen Sie es für £7.49 bei bookshop.theguardian.com. Sand wird das Buch am 14. Oktober an der SOAS, University of London,diskutieren, versobooks.com/events
