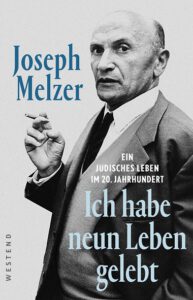von Willy Parlmeyer
 Miko Peled und Nurit Peled-Elhanan sind Sohn und Tochter von Mattityahu Peled, einem hochdekorierten General in Israels frühen Kriegen. In seinem Buch Der Sohn des Generals beschreibt Miko Peled, wie sein Vater mit anderen Generälen 1967 die Regierung zum Angriff auf Ägypten drängt und die militärische Laufbahn aufgibt, als er realisiert, dass der Sieg nicht zum Friedensschluss genutzt wird. Nurit Peled-Elhanan (* 1949) hat 2012 das Buch Palestine in Israeli School Books – Ideology and Propaganda in Education veröffentlicht. Es liegt nun auf deutsch vor unter dem Titel Palästina in israelischen Schulbüchern.
Miko Peled und Nurit Peled-Elhanan sind Sohn und Tochter von Mattityahu Peled, einem hochdekorierten General in Israels frühen Kriegen. In seinem Buch Der Sohn des Generals beschreibt Miko Peled, wie sein Vater mit anderen Generälen 1967 die Regierung zum Angriff auf Ägypten drängt und die militärische Laufbahn aufgibt, als er realisiert, dass der Sieg nicht zum Friedensschluss genutzt wird. Nurit Peled-Elhanan (* 1949) hat 2012 das Buch Palestine in Israeli School Books – Ideology and Propaganda in Education veröffentlicht. Es liegt nun auf deutsch vor unter dem Titel Palästina in israelischen Schulbüchern.
Die Autorin ist Professorin für Literaturwissenschaft und Pädagogik an der Hebräischen Universität Jerusalem. Sie sagt über ihre Studie, diese sei „nicht von einer Historikerin, sondern von einer Diskursanalytikerin verfasst.“ Sie untersuche nicht die Richtigkeit der in den Schulbüchern berichteten Fakten, sondern ihren Diskurs, „besonders ihre Rhetorik und die semiotischen Instrumente, mit denen sie ihre Aussagen übermitteln.“
Es handelt sich um Schulbuchforschung, und diese weiß, dass Schulbücher wirksame Instrumente sind, die dem Staat dazu dienen, nationale und persönliche Identitäten zu formen. Am Schluss des Buches macht die Autorin dies drastisch klar, indem sie Max Weber paraphrasiert, an der Basis des modernen Staates befinde sich nicht der Scharfrichter, sondern der Lehrer, denn das Monopol über die rechtmäßige Bildung sei wichtiger als das Monopol über die rechtmäßige Gewalt. Weiterlesen